
Reportage Portrait Report Vita Impressum
Home
Reportage
Fon:
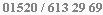
Mail:

Alle halten den Arşch hin
Wer kommt in meine Army? Na jeder! Selbst Türken, die
schon Deutsche sind, müssen zum Militär – auch wenn sie
längst in Deutschland leben. Die zweitgrößte Armee der
Nato braucht ständig Nachschub. Ein Frontbericht.
Dummy, Heft 15, Sommer 2007
Der Mann bestand aus einer grünen Uniform und einer Glatze. Meistens gestikulierte er vor irgendwelchen Schaubildern herum: In der Mitte die Türkei, drumherum die Feinde; Griechenland etwa, oder die Kurden. Während er sprach, kontrollierten Kommandanten die Reihen und passten auf, dass keiner der 200 Soldaten auf seinem abgewetzten, grauen Schalensitz wegnickte. Oder heimlich lachte. Manchmal zeigten sie in der „politischen Bildung“ auch einen Film. Da ging es dann darum, dass Panzer rollten, Soldaten marschierten oder Kanonen schossen. Die Filme hatten übersteuerte, dramatische Musik mit vielen hohen Geigen. An ihrem Ende sah man die türkische Flagge und ein Sprecher sagte: „Sei auch Du dabei!“
Ali Altin (Name geändert) war dabei, wenn auch nur vier Wochen lang: Normalerweise dauert der türkische Militärdienst mindestens acht Monate, im Ausland lebende türkische Staatsbürger haben aber die Möglichkeit, den Aufenthalt erheblich zu verkürzen. 5112, 96 Euro will der türkische Staat dafür haben, im allgemeinen zu entrichten per Bareinzahlung an die„Isbank“ – eine Bank, die es gibt, seit der türkische Staatsgründer Atatürk das so wollte und die noch heute zu einem knappen Drittel seiner Partei gehört.
Die Frau hinter dem Schalter der Isbank-Filiale in Berlin-Kreuzberg war jung, unfreundlich und nahm das Geld von Ali Altin, ohne ihn ein einziges Mal anzuschauen. Ali Altin bekam von ihr eine Quittung, einige Tage darauf kam ein offizieller Brief aus der Türkei, ein Vierteljahr später war er in Burdur, einer Stadt im Südwesten des Landes – gemeinsam mit einigen hundert weiteren Auslandstürken, alle zum selben Stichtag einberufen, alle so ratlos wie er: Sie standen mitten in einer Wartehalle, groß wie ein Bahnhofsgebäude, und in einer Ecke gab es ganze zwei Schalter, an denen die Masse vorbei musste. Irgendjemand schrie: „Hier geht es am schnellsten“, jemand anderes: „Nein, hier!“ Es dauerte einen vollen Tag, bis die Männer registriert waren, geimpft, eingekleidet und in Kompanien eingeteilt. Die von Ali Altin bestand aus drei Amerikanern, einem Australier, drei Briten und fünf Deutschen – zwölf Touristen, aus denen man schnell mal Soldaten gemacht hatte.
Von nun an begannen Ali Altins Tage morgens um fünf - einer Zeit, zu der er sonst in Berliner Clubs Musik macht. 30 Minuten später stand er auf dem Exerzierplatz – und das manchmal für mehrere Stunden; vor ihm eine leere, riesige Tribüne, die von türkischen Flaggen flankiert war, hinter ihm zwei gekreuzte Sturmgewehre aus Eisen – drei Meter lang, aufgebracht auf einer Betonplatte. Wenn er nicht stand, dann marschierte er den Exerzierplatz entlang. Hin und wieder wurde dazu ein Lied gesungen. Nach dem Mittagessen wurde es manchmal komplizierter: Dann musste die Kompanie die Zigarettenkippen auf dem Platz aufsammeln. Sport gab es für Ali Altin nicht: Kurze Zeit vor seiner Ankunft war ein Soldat dabei umgekippt, also wurde alles, was zu anstrengend sein könnte, ersatzlos gestrichen.
Das Essen wurde auf Tellern serviert, welche die Soldaten zuvor mit Schuhputzlappen hatten abtrocknen müssen. Wer es besser haben wollte, konnte zu einer der Würstchenbuden auf dem Gelände gehen. Oder gleich zum kaserneneigenen Supermarkt, der Seife, Obst und Zigaretten verkaufte. Einmal bekam ein Amerikaner einen Tobsuchtsanfall, weil ihm das Essen nicht schmeckte. Zur Strafe wurde er von seinem Kommandanten abgeholt – und ins Restaurant eingeladen. Es hatte sich herausgestellt, dass es sich um den Sohn eines ranghohen Militärs handelte.
In einer Nacht gab es ein Erdbeben. Die Baracken wackelten und die Soldaten lagen ratlos in ihren Betten. Schließlich sagte einer: „Ich schlage vor, wir gehen jetzt raus.“ Sie liefen auf den Exerzierplatz und warteten. Nach zehn Minuten gingen die Sirenen los.
An einem der letzten Tage war die Tribüne plötzlich voll: Generäle waren gekommen, von sonst woher, alle trugen sie Sonnenbrillen. Man spielte Marschmusik, man schoss aus Kanonen und die Soldaten mussten vor den Generälen entlang laufen. Einmal stand einer der Generäle auf, stoppte mit einem Handzeichen die Musik und deutete auf einen der Wehrpflichtigen. Es folgte eine lange, laute Ansprache, anschließend musste sich der Soldat die Uniform richten. Dann ging es weiter. Höhepunkt der Parade war die Vereidigung. Dafür traten die Soldaten an einen Tisch, auf dem ein riesiges Gewehr lag und legten die Hand darauf. Dann mussten sie einen Text nachsprechen – wie er lautet, weiß Ali Altin nicht mehr: Er murmelte stattdessen leise und auf Deutsch die Worte: „Leckt mich am Arsch.“
„Ich verstehe bis heute nicht, warum wir eigentlich
dort
waren.“ Ali Altin ist ein großer, schlanker Mann mit recht hellem,
struppigem Haar. Lange Jahre konnte er den Militärdienst vor sich
herschieben,
als er das Höchstalter von 38 Jahren erreicht hatte, gab es für ihn
keine
andere Wahl: „Ich bin gegen Gewalt. Aber ich wollte keine Auslieferung
riskieren oder bei einer Verweigerung meine bürgerlichen Rechte in der
Türkei
verlieren.“ Dabei hatte Ali Altin noch Glück: Türken, die nicht im
Ausland
leben, müssen in jedem Fall den vollen Militärdienst ableisten. Wer
Pech hat,
muss kämpfen, etwa gegen die PKK. Und das als simpler
Wehrdienstleistender.
Wenige Länder auf der Welt haben eine Gesellschaft,
die so
sehr vom Militär geprägt ist wie die der Türkei: Mehr als eine halbe
Million
Menschen hat das Land permanent unter Waffen, außer den Truppen der USA
gibt es
in der Nato keine größere Armee. Trotzdem beteiligt sich die Türkei
vergleichsweise selten an zwischenstaatlichen Konflikten, seit dem
zweiten
Weltkrieg gilt das lediglich für den Koreakrieg von 1950 bis 1953 sowie
die
Besetzung Nordzyperns 1974. Statt dessen dominiert das Militär im
Inneren:
Schätzungen zufolge hat der Kurden-Konflikt seit den 80er-Jahren 30.000
Menschen das Leben gekostet. Ganze dreimal in der Geschichte der
Republik
putschte sich die Armee an die Macht, zuletzt 1980. Und auch die
aktuelle
Staatskrise, die in Neuwahlen in diesem Monat mündete, wurde nur
ausgelöst
durch eine Putschdrohung: Der Generalstab war mit dem islamisch
geprägten
Präsidentschaftskandidaten Abdullah Gül nicht einverstanden – und ließ
über das
Radio verbreiten, man werde notfalls „offen Position“ beziehen. Nicht
wenige
bezeichnen das politische System der Türkei daher noch heute als
„Militärdemokratur“.
Entsprechend schwer ist es für einen Türken, sich dem Griff des Militärs zu entziehen: Einen Zivil- oder vergleichbaren Ersatzdienst gibt es nicht, dafür müssen sich viele Türken um ihre eigene Einziehung kümmern: Die Infrastruktur funktioniert nur bedingt, nicht jeder bekommt den Einberufungsbefehl tatsächlich zugestellt. Wer es riskiert, sich über Jahre hinweg nicht beim Militär zu melden, kann Pech haben – und nach einer der zahlreichen Straßenkontrollen direkt in der nächstbesten Kaserne landen. Auch ist es schwer, sich ausmustern zu lassen: Die Anträge werden genauestens geprüft. Und wer angibt, er leide unter der Krankheit „Homosexualität“, muss das dokumentieren: Mitunter gibt sich das Militär nicht mal mit einem Privatporno zufrieden, sondern untersucht gleich noch den Anus.
Ekrem Özdemir musste nicht kämpfen, sondern Befehle erteilen. Und sein Armeedienst dauerte nicht etwa vier Wochen, sondern volle 16 Monate: Nach seinem Studium in Ankara musste er in einem Formular angeben, ob er lieber acht Monate als Soldat dienen wolle oder 16 als sogenannter „Ersatzoffizier“. Er machte sein Kreuzchen bei der kürzeren Variante – es half nichts, Juristen waren gefragt.
Heute lebt Ekrem Özdemir in Berlin-Kreuzberg und arbeitet als Rechtsanwalt. Er trägt einen hellbraunen Anzug und kurze, schwarze Locken. Seine Fingernägel sind sauber geschnitten, die Zähne blendend weiß. „Man muss seine Pflicht erledigen. Die Türkei braucht eine Armee. Nur in einer Idealwelt ist das nicht nötig.“ Ekrem Özdemir bewegt sich wenig und mit Bedacht, nur manchmal schielt er auf seine goldene Uhr.
Auch wenn Ekrem Özdemir das nicht unbedingt so gewollte hatte: Er war zur Elite auserkoren, also fügte er sich. Es begann mit der Grundausbildung, für ihn vier Monate in der „Wehrdienstakademie“ in der Küstenstadt Izmir. Er lernte dort in seiner eigenen Klasse, mit eigenem Fachgebiet: Bau. Man brachte ihm bei, wie man einen Graben aushebt, eine Panzersperre aufstellt, eine Mine ausgräbt – oder eine verlegt.
Das alles konnte er anschließend jedoch erst mal vergessen, nach dem vierten Monat schickten sie ihn zum Gericht. An dem Ort, der sich „Türkische Republik Nordzypern“ nennt und der sich als souveräner Staat begreift, unterhält die Türkei Militärgerichte. An einem davon konnten sie Ekrem Özdemir gebrauchen – als Staatsanwalt, genauer: als Assistent des dafür zuständigen Offiziers. „Aber der hatte keine Ahnung.“ Wenn ein Soldat beim Wachdienst geschlafen hatte, zu spät aus dem Urlaub gekommen war oder zwei sich gestritten hatten, dann erhielt er jetzt eine Akte – jedenfalls dann, wenn der zuständige Kommandant den Vorfall für wichtig genug gehalten hatte, ihn dem Gericht zu melden und nicht einfach selbst eine Strafe ausgesprochen hatte. Ekrem Özdemir erarbeitete die Plädoyers seines Vorgesetzten, manchmal vertrat er ihn auch.
Es war ein kleines Gericht: Direkt angeschlossen an eine Kaserne, die Fälle waren kleine Fische. Eine härtere Strafe als drei Monate Militärgefängnis durften die Richter nicht aussprechen, alles andere ging an übergeordnete Instanzen. Meistens waren die Soldaten geständig: „Ja, ich habe geschlafen, aber nur für fünf Minuten“, hieß es dann. Anschließend überlegten sich die drei Richter jeweils einzeln eine Strafe, waren sie sich uneins, rechnete man eben den Mittelwert aus. Wenn sie dann jemanden zu seinen zehn Tagen Gefängnis verurteilt hatten, sei die Reaktion meist gar nicht so extrem gewesen. „Vielleicht waren die Bedingungen im Gefängnis besser als bei der Armee“, sagt Ekrem Özdemir. Einen Verteidiger hat er in seinen neun Monaten beim Militärgericht nicht zu Gesicht bekommen. Aber wenn ein Soldat das so gewollt hätte, sei das durchaus möglich gewesen. Schließlich ging alles mit rechten Dingen zu. „Für manche Soldaten war es bequemer, einfach nichts zu machen.“ Ekrem Özdemir schaut jetzt öfters auf seine Uhr.
Die letzten drei Monate seines Dienstes war Ekrem Özdemir für eine Hundertschaft zuständig, wenn auch gemeinsam mit weiteren Offizieren. Er blieb in Nordzypern und bekam von oben Pläne zugeteilt, die er dann jeden Tag mit einem Teil der Soldaten umsetzte: Sport treiben etwa, oder etwas bauen. Einen Soldaten hatte er dabei, der nicht so recht wollte; der immer versuchte, es sich leicht zu machen und absichtlich langsam arbeitete. Ekrem Özdemir konnte das gut verstehen, schließlich war es heiß. Trotzdem fertigte er eine Akte über den Soldaten an. Was damit passiert ist, weiß er nicht. Es interessiert ihn auch nicht. „Ich finde das System des Militärs sehr interessant, die anonyme Macht, die es über Menschen ausübt. Es funktioniert seit Tausenden von Jahren. Und irgendjemand muss die Befehle geben.“
Was die Türkei nicht kennt, sind Kriegsdienstverweigerer. Jeder, der den Dienst aus Gewissensgründen ablehnt, gilt als Deserteur. So wie Osman Murat Ülke. Ihn erreichte der Einberufungsbefehl – rein zufällig gerade ihn, der er schon lange als antimilitaristischer Aktivist bekannt war. Osman Murat Ülke desertierte mit einem Feuerzeug, mit dem er seinen Einberufungsbefehl in Brand setzte. Mitten in der Großstadt Izmir. Vor Journalisten. Das war am 1. September 1995.
Der erste, der den Deserteur Osman Murat Ülke in seiner Einzelzelle besuchte, war eine Ratte. Sie war ihm das Bein hochgelaufen und er bemerkte sie erst, als sie schon oberhalb seines Knies war. Nach einigen Tagen hatten sich die Tiere an seine Anwesenheit gewöhnt. Sie kamen jetzt nur noch nachts, manchmal, und krabbelten auf seiner Decke herum. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon aufgeräumt und den Rattenkot weggekehrt, der zuvor den ganzen Zellenboden bedeckt hatte.
Bald schon war er die Ratten ganz los: Er trat in den Hungerstreik, außerdem weigerte er sich standhaft, die Gefängnisuniform anzuziehen. Also steckten sie ihn in eine Dunkelzelle. Dort gab es einen hohen Betonklotz, auf dem Holzbretter lagen, drei Decken und eine Toilette, über der ein Wasserhahn angebracht war. Zum Trinken musste er sich über die Schüssel beugen. Platz zum Umherlaufen gab es nicht. Und keine Heizung, mitten im Winter. Manchmal hatte er das Gefühl, plötzlich aufzuwachen – obwohl er gar nicht geschlafen hatte. Nach fünf Tagen holten sie ihn raus.
Die Einzel- und die Dunkelzelle waren nicht die ersten, die Osman Murat Ülke nach seiner Verhaftung zu sehen bekam, ebenso wenig die letzten: Bis zum Jahr 1999 war er mit Unterbrechungen 701 Tage in Haft, an sieben verschiedenen Orten. Er sah Zivil- und Militärgefängnisse, war in Isolationshaft und in Gemeinschaftszellen, teilte sich diese mit anderen politischen Gefangenen oder mit verurteilten Mördern.
Doch chaotisch waren nur die ersten Monate – irgendwann wurde seine Haft zum Spiel, dessen Regeln sich leicht begreifen ließen: Alle paar Monate kamen Soldaten vorbei und eskortierten ihn zur Kaserne in Bilecik, einer Provinzstadt etwa 100 Kilometer südöstlich von Istanbul. Dort weigerte sich Osman Murat Ülke, eine Militäruniform anzuziehen. Anschließend ging es wieder zurück ins Gefängnis, gelegentlich auch vor das Militärgericht, wo er verurteilt wurde, wahlweise wegen Desertion, Befehlsverweigerung oder auch wegen „Distanzierung des Volkes vom Militär“. Hatte er eine seiner zahlreichen Strafen verbüßt, holte man ihn wieder aus dem Gefängnis und das Spiel ging von vorne los. Genützt hat das dem Militär wenig: „Ich fühlte mich stark. Sie konnten mir antun, was sie wollten – aber sie hatten keine Macht, mich irgendetwas tun zu lassen.“
Das muss schließlich auch das Militär gemerkt haben: Irgendwann verlor es die Lust und ließ sich willfährig austricksen: Als Osman Murat Ülke einmal wegen Befehlsverweigerung einsaß, fanden seine Anwältinnen einen Paragraphen, der besagte, dass nur Deserteure von Soldaten zur Kaserne eskortiert werden dürfen. Das galt für ihn in diesem Fall nicht. Also bekam er nach seiner Strafe lediglich eine mündliche Aufforderung, sich in Bilecik zu melden – was er nicht tat. Seit diesem Ereignis im Jahr 1999 gilt Osman Murat Ülke als Deserteur, die Behörden kennen seinen Aufenthaltsort – aber sie holen ihn nicht von dort ab. Bis heute.
Doch Osman Murat Ülke hat seine Freiheit gewiss nicht dem Großmut des türkischen Militärs zu verdanken. Das wird deutlich anhand eines Urteils, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 25. Januar 2006 über die Türkei sprach: Das Land wird darin ausdrücklich für die Behandlung Ülkes gerügt, diese diene ausschließlich dazu, „Gefühle von Angst, Schmerzen und Verwundbarkeit in ihm auszulösen, um ihn so zu demütigen und zu entwürdigen und um seinen Widerstand und Willen zu brechen“, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Osman Murat Ülke ist zum Politikum geworden. Was eine neuerliche Verhaftung für die EU-Beitrittsperspektive der Türkei bedeuten würde, ist naheliegend.
Somit könnte das Urteil für türkische Kriegsdienstverweigerer einen großen Schritt bedeuten. Könnte: Zwar gibt es nicht wenige Türken, die dem Militär in irgendeiner Weise entkommen wollen – doch sie arbeiten alle für sich. Der organisierte Widerstand ist klein, zerstritten und oft radikalisiert: Anarchisten agieren gegen Marxisten, manche Gruppen plädieren für einen Ersatzdienst, für andere kommt nur die Totalverweigerung in Frage. Im Januar dieses Jahres traf man sich immerhin zu einer Konferenz. In der Abschlussresolution steht – nichts. So konnte eine Spaltung vermieden werden.
Für Osman Murat Ülke ist es noch lange nicht vorbei.
Er lebt
in der Illegalität, ist nirgendwo gemeldet, hat keinen Pass, keine
Krankenversicherung. Offiziell existiert er nicht und kann das Land
daher nicht
verlassen. Sollte sich die Politik der Türkei in den nächsten Jahren
ändern,
dann wird Osman Murat Ülke das schnell zu spüren bekommen: Dann werden
Soldaten
vor seiner Tür stehen und ihn zur Kaserne in Bilecik begleiten. Und
Osman Murat
Ülke wird sich weigern, eine Uniform anzuziehen.