
Reportage Portrait Report Vita Impressum
Home
Report
Fon:
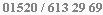
Mail:

In der Rezession versprechen Unternehmen
den Kosumenten vor allem eins: Wir
stehen das gemeinsam durch
Der Freitag, 23.07.2009
Die größte Krise seit 1929 führt nicht nur zu Bankenverstaatlichung und Kaufhaussterben, sondern wirbelt auch andere Wirtschaftsbereiche gründlich durcheinander. Ganze Geschäftsmodelle gründen mittlerweile auf der Angst vor dem Untergang. Und wer kein zur Krisenstimmung passendes Produkt anzubieten hat, ändert eilig Werbe- und Marketingstrategien. Der Ton der Kampagnen schwankt dabei zwischen Alarmstimmung und einlullender Beruhigung. Windige Anbieter werfen überflüssige Produkte auf den Markt, gleichzeitig versprechen Großkonzerne ihren Kunden völlige Sicherheit. Welche Form der Ansprache ein Anbieter wählt, hängt davon ab, was er verkaufen will. Und welches Menschenbild er zugrunde legt.
Das Simpelste, was ein Unternehmen versprechen kann, ist: Rettung. Und in Zeiten der großen Krise kann man so ziemlich alles retten: Geld, das Seelenheil oder das nackte Überleben. „Mit Essen im Magen lässt sich vieles ertragen!“, bewirbt ein Konservenproduzent selbsterhitzende Dosenmahlzeiten, indem er auf die schweren Zeiten verweist. Die Dosen seien nicht nur fürs Camping geeignet, sondern auch „bei Zivilisationsausfall“.
Dazu kann man Zeitschriften abonnieren, die fragen: „Passen Sie ins Beuteschema der Vermögens-Vernichter?“ Oder man kauft Bücher, die den Leser anschreien: „Retten Sie Ihr Vermögen!“ Viele dieser Publikationen erscheinen abseits des Mainstreams in einer Art Krisen-Subkultur der schnellen Antworten. Nicht selten erschöpfen sich die Erklärungsversuche der Krise dabei bereits in der Nennung von Namen wie „Rothschild“ oder anderer Bankhäuser, deren Gründer jüdisch waren. Man ahnt, welches Weltbild dahinter steckt.
Raum für Abseitiges
Das schnelle Hilfsversprechen mit den simplen Lösungen schafft es mittlerweile auch ins Fernsehen, zumindest ins Programm der Spartensender. „In Krisenzeiten senken viele Firmen ihre Marketing- und Werbeetats. Die Medien müssen daher die Preise für Werbung senken. So wird Werbung billiger und auch für Unternehmen interessant, die sich das eigentlich nicht leisten können“, sagt Johannes Berentzen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Münster und untersucht das Werbeverhalten von Unternehmen. Die gekürzten Etats der großen Konzerne sorgten dafür, dass viel Krudes eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Und: „In der Krise gibt es mehr Werbung, die Sorgen und Ängste potenziert.“
Nicht jedes Unternehmen verfügt dabei über ein Produkt, das gut in die Krise passt – dann wird einfach suggeriert, dass dem dennoch so wäre: So könnte man meinen, IT-Sicherheitsfirmen seien gerade in Zeiten des Aufschwungs gefragt, in denen Unternehmen viele Produkte entwickeln, die sie gegen Industriespionage schützen müssen. Aber für den Dienstleister Kroll Ontrack ist genau das Gegenteil richtig. „Finanzkrise verleiht den Unternehmensdaten Flügel“, lässt das Unternehmen im schönsten PR-Floskelsprech verlauten. Zynisch ist dabei die Argumentation, warum es einen erhöhten Bedarf an IT-Sicherheit gebe. „Drohende oder bereits vollzogene Entlassungen lassen auch die Moral der Beschäftigten sinken“. Nicht, dass am Ende ein gefeuerter Mitarbeiter Daten mitgehen lässt oder an die Konkurrenz weiterreicht. So kann man die Rezession natürlich auch zur Chance für die eigene Firma umdeuten.
Noch schlimmer von der Krise getroffen sein dürften nach normalem Verständnis Fernsehsender, die sich ausschließlich über Werbung finanzieren. Die Pro7-Sat1-Senderkette sieht sich dennoch als Gewinner: „In Zeiten der Rezession verändern die Konsumenten ihr Medienverhalten. Das Bedürfnis nach Ablenkung und Unterhaltung steigt“, teilt man potenziellen Werbekunden mit. Dabei outet man sich mit dem größten Selbstverständnis zugleich als Verwahranstalt für Frustrierte. Dass Pro7-Sat1 kein Krisengewinner ist, verrät dabei schon ein kurzer Blick auf die aktuellen Quartalszahlen: Der Konzern meldet einen Verlust von 66,2 Millionen Euro.
Die Menschen, an die sich solche Krisen- Verkaufsstrategien wenden, sind offenbar rachsüchtig, resigniert oder auch panisch – gerade so, wie es zum jeweiligen Produkt passt. Und man hat natürlich immer etwas, das den Kunden helfen kann. Generell gilt: Je größer das Unternehmen, desto freundlicher wird der Ton – ganz so, als ob permanentes Schulterklopfen gegen die Verunsicherung hilft.
„Jede Krise ist auch eine Chance“ ist nicht etwa der Titel eines Selbstfindungsseminars, sondern ein Satz, den die Dresdner Bank auf die Startseite ihres Webauftritts stellt. Im Therapeutensprech bietet man den Verunsicherten dann „Beratungsangebote“. Auch der Spruch „Vor uns liegt eine klare neue Welt“ ist keine Einladung zum Gottesdienst, sondern eine neue Kampagne des Softwareriesen SAP. Die SAP-Seite klareneuewelt.de bietet dann Menüpunkte wie: „Klarheit – ein Überblick“, „Klare Fallstudien“ und „Klarheit mit SAP“. In schöner neuer Klarheit vermeidet die Firma Worte wie „Krise“, betont stattdessen, dass „Herausforderungen“ bevorstehen.
„Solche Werbung ist krisentypisch – ein Sprachcode, der recht offen an das berühmte Wort von Kennedy erinnert, demzufolge jede Krise ein Teil einer Chance ist“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Berentzen. Zumindest rhetorisch will man näher an die Verbraucher heranrücken – und versucht eine Gemeinschaft zu konstruieren, die von den Unbillen der Krise wie von einem plötzlich heraufgezogenen Unwetter getroffen wurde. Das zeigt auch die Studie „Werbetrends 2009“ der Agenturen „Trendbüro“ und „Slogans.de“. Sie haben die Sprache von über 5.000 Werbeslogans ausgewertet.
Der meistverwendete Begriff in der Werbung ist in diesem Jahr bisher das schlichte Wort „wir“ – dicht gefolgt von den Wort „gemeinsam“, das seinen Anteil in den letzten Jahren glatt vervierfacht hat. Als habe Obama mit „Yes, we can“ die Formel vorgegeben, mit der nun auch Unternehmen mit Absatzsschwierigkeiten durch die Krise kommen wollen.
„Die Sehnsucht nach Sicherheit greifen Marken auf, indem sie sagen: ‘Wir sehen uns nicht mehr als Obrigkeit, sondern wir verstehen euch’“, sagt Alexander Hahn, der als Geschäftsführer von Slogans.de an der Sprachstudie mitgearbeitet hat. Deutlich wird dieser Wandel etwa an einem aktuellen Coca-Cola-Spot, in dem eine große Familie um einen Tisch versammelt ist – natürlich mit reichlich Coca-Cola in der Mitte des Tisches. Der Slogan des Spots mutet an, als sei er aus den Fünfzigern: „Coca-Cola deckt den Tisch.“ Die Marke soll hier nicht – wie oft in den Boomjahren – Kultobjekt sein, sondern selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. „Der Trend geht eindeutig in Richtung sozialer Werbung“, sagt Hahn. „Das übersteigerte Selbstbewusstsein, mit dem viele Firmen in den letzten Jahren aufgetreten sind, funktioniert nicht mehr. Wenn jemand zu viel verspricht, kaufen ihm das die Leute nicht mehr ab.“
Eine Zeitung entschuldigt sich
Manche Unternehmen gehen sogar noch ein Stück weiter und machen aus einstigem Selbstbewusstsein nun Demut: So etwa der Evening Standard, eine Londoner Lokalzeitung, deren Auflage in letzter Zeit kontinuierlich gesunken ist – teils wegen der Krise, teils wegen schlechtem Journalismus. Letzteres scheint man beim Evening Standard selbst zu denken, denn gegenwärtig plakatiert das Medienhaus in London Werbung, auf der man sich für die Berichterstattung der vergangenen Jahre entschuldigt. Dafür, dass man vorhersehbar und selbstgefällig war – und dafür, dass man die Leser als selbstverständlich hingenommen hat.
„So etwas passt in die Zeit, weil da jemand Offenheit gegenüber den Konsumenten zeigt“, meint Hahn. Dass ein Unternehmen eine vergleichbare Kampagne in Deutschland wagt – Anlässe sich zu entschuldigen, gäbe es schließlich auch hierzulande –, glaubt Hahn nicht: „Werbung ist in Deutschland eher konservativ. Das liegt auch an den Konsumenten, die eher analytisch an die Spots herangehen. Wenn einer zuviel wagt, fragen sich die Leute gleich, wie sie da manipuliert werden sollen.“
Dadurch bekommen vor allem jene Unternehmen ein Problem, die momentan unter besonders großem Vertrauensverlust leiden: Einerseits müssen sie offen sein – andererseits aber bitte nicht zu sehr, weil das wieder Misstrauen erwecken könnte. Was bleibt, ist dann das endlos wiederholte „Wir!“ – ohne dass dies mit Inhalt gefüllt würde. Vertrauensbildung soll durch mantrahafte Wiederholung funktionieren.
Wer Gläubige sucht, der muss die frohe Botschaft aber auch selbst leben: Vorgemacht hat das die Dresdner Bank, die es seit der Übernahme durch die Commerzbank nur noch als Marke gibt, nicht mehr als eigenständiges Unternehmen – und die dadurch zu einem Konzern gehört, der nur durch eine Teilverstaatlichung am Leben erhalten wurde. Das aber scheint in der Logik der Dresdner Bank kein Problem zu sein. Auf ihrer Webseite bewirbt sie die Fusion mit den Worten: „Gemeinsam mehr.“