
Reportage Portrait Report Vita Impressum
Home
Reportage
Fon:
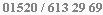
Mail:

Der Zauber von Hogewey
In den Niederlanden leben 152 Demenz-Kranke in einem künstlichen
Dorf. Dort haben sie das Gefühl, noch ganz normal zu leben.
Und deshalb geht es ihnen besser, sagen die Ärzte.
Berliner Zeitung, 26.10.2010
In den Niederlanden leben 152 Demenz-Kranke in einem künstlichen
Dorf. Dort haben sie das Gefühl, noch ganz normal zu leben.
Und deshalb geht es ihnen besser, sagen die Ärzte.
Berliner Zeitung, 26.10.2010
Man
merkt es an den Türen. Nicht an den großen Eingangstüren mit den
massiven Holzrahmen und den Glasfenstern, sondern an den kleinen Türen,
die mit der Umgebung verschmelzen und die sich hinter der
Holzverkleidung der Außenwände verstecken. Die Häuser hier in Hogewey
haben eine große Tür, durch die Besucher hineinkommen, und eine kleine
Tür, die nur der Arzt benutzen darf, wenn es einen Notfall gibt. Es ist
wie auf einer Theaterbühne, wo die Techniker hinter der Tapetenwand
verschwinden, wenn die Schauspieler an der Rampe ihren Auftritt haben.
Und es sind diese kleinen Sachen, an denen man merkt, dass diese Häuser
so ungewöhnlich sind wie ihre Bewohner.
Hogewey liegt in den Niederlanden, und es ist, wenn man das so sagen will, ein kleines Theaterdorf. 152 Menschen leben hier seit Dezember 2009, sie alle leiden an fortgeschrittener Demenz. Die Bewohner von Hogewey sind unfähig, ihr Leben selbst zu organisieren, und doch leben sie in einer Welt, die genau das von ihnen zu verlangen scheint. Hogewey ist ein Dorf, dessen Einwohner unter anderem im Supermarkt einkaufen können, eine Galerie besuchen oder im
Restaurant essen gehen.
Da sie genau das aber nicht mehr können, ist Hogewey auch eine gigantische Täuschung. Die Bedienung im Restaurant, der Friseur, ja selbst der Arzt, der eine Praxis betreibt, statt zu den Dorfbewohnern selbst zu kommen - all diese Menschen sind im Nebenberuf Darsteller ihrer selbst und helfen dabei, das
möglich zu machen, was eigentlich nicht mehr geht. Die Erschaffung dieser künstlichen Welt hilft dementen Menschen, weil es gut für sie ist, wenn sie möglichst wenig aus der Realität herausgerissen werden, sagen Forscher. Das Theater, in dem sie selbst die Hauptrollen spielen, ist eine Art unfreiwillige Gruppentherapie.
Wer nach Hogewey kommt und noch Herr seiner Sinne ist, der hat kein Problem mit der dezenten Glastür. Eine freundliche Dame hinter einem Schalter drückt auf einen Knopf, es summt, die Tür geht auf. Für die Bewohner aber ist hier Schluss, Hogewey ist nicht größer als ein Factory Outlet, das hier in den Amsterdamer Vorort Weesp auch bestens hinpassen würde.
Hinter der Glastüre, die die wirkliche Welt von dem Theaterdorf trennt, beginnt eine Fußgängerzone mit rotgeklinkerten Wegen zwischen rotgeklinkerten Flachbauten. Einen Springbrunnen gibt es hier, Skulpturen und neu gepflanzte Bäume, deren Kronen entlang der eingelassenen rechteckigen Gitter geschnitten sind. Im Schaufenster des Friseurladens hängen drei Plakate, auf denen drei junge Frauen drei Frisuren tragen.
Schwarze Klobrillen
"Wer an Alzheimer leidet, der verliert ohnehin schon den Bezug zum Leben. In einem gewöhnlichen Pflegeheim verlieren die Menschen diesen Bezug noch
mehr." Isabel van Zuthem, 40 Jahre alt, ist Sprecherin von Hogewey, zugleich aber auch ausgebildete Betreuerin. Im Restaurant, in dem sie einen Kaffee trinkt, ist wenig los, es ist ja auch noch relativ früh am morgen. Nur einer von einem guten Dutzend Tischen ist besetzt, eine Gruppe von Patienten isst. Einige von ihnen sitzen im Rollstuhl, sie sind so leise, dass man sie kaum wahrnimmt. "Es ist sehr wichtig, dass alles so normal wie möglich ist. Die Leute leben nachweislich länger, wenn die Umgebung stimulierend ist", sagt Isabel van Zuthem.
Stimulierend, das heißt in erster Linie normal und vertraut. Wie etwa die Klobrillen, die in Hogewey schwarz sind, wie es in den Niederlanden üblich ist, und nicht weiß, wie in den meisten Pflegeheimen. "Weiße Brille, weißer Fußboden - die Leute kennen das nicht und begreifen dann oft gar nicht, dass sie eine Toilette vor sich haben", sagt Isabel van Zuthem. Genauso ist es mit den Radios, in Hogewey sind das massive Geräte, die aussehen wie vor vierzig Jahren. "Demente Menschen gehen in der Zeit zurück. Wenn ich etwa sage: "Die Schlüssel liegen neben dem Radio' und damit ein modernes Radio mit Digitalanzeige meine, dann finden die Bewohner die Schlüssel nicht, weil sie das Radio nicht erkennen." Das Beiläufige ist kein Zufall in Hogewey.
Diese Welt hier ist ähnlich künstlich und durchdacht wie die des Truman Burbank aus dem Film "Die Truman Show". Im Film ist die Stadt Seahaven eine
Scheinwahrheit. Die Versicherung, die den gutgläubigen Truman angestellt hat, die Magazine, die er im Kiosk kauft, ja, sogar die Frau, die er geheiratet hat; nichts davon ist echt. Seahaven ist die komplette Illusion, nur geschaffen, um Truman Burbank in Szene zu setzen, der ohne sein Wissen der Star einer Reality-Serie ist. Die meisten Straßen in Seahaven sind übrigens rotgeklinkert.
Wer als Besucher nach Hogewey kommt, der kann in den kleinen Supermarkt gehen, sich eine Cola aus dem Kühlfach nehmen und sie bei Trudy Vernoy bezahlen. Vernoy, 51, ist die Kassiererin, jedenfalls für Gäste. Wer als Bewohner in den Supermarkt geht, muss am Ende ebenso an der Frau mit den blonden Locken und den kleinen Ringen unter den Augen vorbei, das Bezahlen kann er aber buchstäblich vergessen. Und wenn einer der Einwohner von Hogewey die Cola einfach nicht finden kann, das Shampoo oder das Gemüse, dann geht Trudy Vernoy gemeinsam mit ihm durch den Laden, solange bis der Einkaufskorb voll ist. "Ich fühle mich als Supermarktverkäuferin", sagt sie. "Aber ich arbeite hier, weil es schön ist, solche Dinge gemeinsam mit den Bewohnern zu erleben." Sämtliche Waren, die in den Regalen liegen, abzüglich des einen oder anderen Schokoriegels oder Softdrinks, die Besucher kaufen - sie decken nur den Bedarf des Wohnheims. Alles wäre ohnehin hier, nur dass es in Hogewey niemanden gibt, der einmal am Tag ins Lebensmittellager geht. Und auch kein Lebensmittellager.
"Wenn man ein Theaterstück aufführt, dann gibt es Dinge, die auf der Bühnpassieren, und solche, die Backstage ablaufen", sagt Hogewey-Sprecherin Isabel van Zuthem. "Bei uns ist das auch so. Backstage ist alles wie in einem Heim. Aber die Bewohner sehen das nicht. Für sie ist alles so normal wie möglich."
"So normal wie möglich", das bedeutet etwa, dass die Einwohner von Hogewey ihren Tag so leben sollen, wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Wer hier wohnt, muss etwa seine Wäsche waschen, trocknen und zusammenlegen. "Backstage" bedeutet, dass tatsächlich aber niemand seine Wäsche waschen muss, trocknen und zusammenlegen - wer das alles nicht mehr kann, dem helfen die Betreuer. Da diese aber auf der Bühne agieren, tragen sie keine weißen Kittel, sondern einfach Straßenkleidung.
Die Aufführung funktioniert, und zwar an vielen Stellen so gut, dass ihre Hauptdarsteller begeistert mitspielen. Für Isabel van Zuthem zeigt sich das besonders gut am Beispiel jener alten Dame, die vor Langeweile verfiel und deshalb jeden Tag Besuch von ihrer Tochter bekam - die der Mutter doch nur bei ihrem Niedergang zusehen konnte. Seit es wieder einen Haushalt zu führen gibt, hat sich das grundlegend geändert. "Jetzt beklagt sich die Tochter, dass ihre Mutter nie Zeit für sie hat. Es gibt einfach zu viel für sie zu tun", sagt van Zuthem.
Hogewey ist eine ziemlich perfekte Welt. Die Plastikstühle um den Springbrunnen herum leuchten in vier Signalfarben von Indigo bis Neongrün, auf den Beeten wächst kein Unkraut, in den Straßen liegt kein Müll. Hogewey ist akkurat - und gerade deshalb auch grotesk, denn umrahmt wird das Grundstück von zwei angrenzenden grauen Plattenbauten. Dieses kleine, niedliche Paralleluniversum wird von Achtgeschossern überragt, deren Fassaden von Satellitenschüsseln übersät sind. Die künstliche und die reale Welt stehen hier in einem seltsamen Wettstreit beieinander.
Es ist das diffuse Wissen um die Falschheit seiner Welt, das den Versicherungsangestellten Thomas A. Anderson quält. Unter dem Pseudonym "Neo" gerät die Hauptfigur des Films "Matrix" schließlich an eine Gruppe von Untergrundkämpfern, deren Anführer ihn vor die Wahl stellt, eine von zwei unterschiedlichen Pillen zu schlucken: Eine blaue Pille, die ihn alle Zweifel vergessen lässt und in sein bisheriges Leben zurückführt - oder eine rote Pille, die ihn aus der ihm bekannten Welt unwiederbringlich hinauskatapultiert. Neo wählt die rote Pille, natürlich, und lernt eine höhere Ebene der Realität kennen.
In Hogewey bekommen die Menschen die blaue Pille verabreicht und das gewissenhaft. Wer nach Hogewey geht, bezieht nicht einfach eine Wohnung, sondern er wird seinem Milieu entsprechend untergebracht. Leute, die vor der Erkrankung gerne ins Theater gingen, leben in der "kulturellen Gruppe", in der man sie erst am späten Vormittag weckt und häufig französisches und italienisches Essen serviert. Wer vom Land kommt, lebt in der "häuslichen Gruppe" mit massiven Holzmöbeln und Kartoffelbrei.
Menschen aus wohlhabenden Verhältnissen in der "Schicken Gruppe" mit klassischer Musik aus dem CD-Player und einem Rotweinsortiment in der Glasvitrine. Und da in den Niederlanden viele indonesische Migranten leben, gibt es auch in Hogewey eine entsprechende Wohngruppe; die Heizung ist hier immer ein paar Grad höher gedreht, denn die Indonesier haben es gerne warm, sagen die Betreiber. Sieben Lebensstile stehen in Hogewey zur Verfügung; der Welt, in der die Plastikstühle vier verschiedene Farben haben und die Wege rot geklinkert sind. Die Kosten für die Unterbringung, etwa 5000 Euro monatlich, zahlt die staatliche Pflegeversicherung.
Tiere stellen keine Fragen
Was vielleicht noch fehlt, ist ein kleiner Bauernhof - darauf verweist zumindest Hans-Jürgen Freter, Sprecher der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, wenn man ihn mit der Frage konfrontiert, ob es in Hogewey mit der Illusion nicht ein wenig übertrieben wird.
"Es kommt immer darauf an, eine geeignete Umgebung für den jeweiligen Menschen zu finden. Tiere sind zutraulich und stellen keine verwirrenden Fragen", sagt Freter - und spielt damit an auf das heutige Leben des Schriftstellers Walter Jens. Jens, seit 2004 an Demenz erkrankt, füttert heute Kaninchen auf einem Bauernhof, wie sein Sohn Tilman Jens vergangenes Jahr in einem Buch der Öffentlichkeit darlegte. Das ist vielleicht weniger spektakulär als die Existenz von Hogewey, beruht aber auf demselben Grundgedanken: "Demenzkranke sollten in einem Umfeld leben, das leichte Orientierung, Geborgenheit und Sicherheit gewährt", so Freter.
Und dennoch, darf man das? Was unterscheidet eigentlich die Welt Hogeweys von der des Truman Burbank? Einiges, findet Isabel van Zuthem: "Klar ist Hogewey auch Illusion. Aber nicht nur, denn alles funktioniert auch so. Demnächst ist wieder eine Aufführung im Theater und wenn Sie etwas feiern wollen, können Sie das Café mieten." Hogewey, das ist ein Supermarkt, ein Friseur, ein Beautysalon, ein Pflegeheim, Nichts von alledem und alles zugleich.
Einmal gab es einen Moment, in dem sich ein Fehler in die Aufführung schlich. Als Hogewey bezugsfertig war und die ersten Menschen aufnahm, da fehlte noch etwas, woran die Bewohner ihre Jacken hätten aufhängen können. Nicht, dass sich jemand direkt beschwert hätte. Aber jedem, der seine Wohnung verließ, fehlte etwas, das zum Hinausgehen gehört. Und jedem, der sie betrat, etwas, das zum Heimkommen gehört. "Eine Jacke gehört an den Kleiderhaken. Das muss so sein, und weil es nicht ging, wurden die Leute unruhig", sagt Isabel van Zuthem. Als hätte man rote Pillen verabreicht.
Hogewey liegt in den Niederlanden, und es ist, wenn man das so sagen will, ein kleines Theaterdorf. 152 Menschen leben hier seit Dezember 2009, sie alle leiden an fortgeschrittener Demenz. Die Bewohner von Hogewey sind unfähig, ihr Leben selbst zu organisieren, und doch leben sie in einer Welt, die genau das von ihnen zu verlangen scheint. Hogewey ist ein Dorf, dessen Einwohner unter anderem im Supermarkt einkaufen können, eine Galerie besuchen oder im
Restaurant essen gehen.
Da sie genau das aber nicht mehr können, ist Hogewey auch eine gigantische Täuschung. Die Bedienung im Restaurant, der Friseur, ja selbst der Arzt, der eine Praxis betreibt, statt zu den Dorfbewohnern selbst zu kommen - all diese Menschen sind im Nebenberuf Darsteller ihrer selbst und helfen dabei, das
möglich zu machen, was eigentlich nicht mehr geht. Die Erschaffung dieser künstlichen Welt hilft dementen Menschen, weil es gut für sie ist, wenn sie möglichst wenig aus der Realität herausgerissen werden, sagen Forscher. Das Theater, in dem sie selbst die Hauptrollen spielen, ist eine Art unfreiwillige Gruppentherapie.
Wer nach Hogewey kommt und noch Herr seiner Sinne ist, der hat kein Problem mit der dezenten Glastür. Eine freundliche Dame hinter einem Schalter drückt auf einen Knopf, es summt, die Tür geht auf. Für die Bewohner aber ist hier Schluss, Hogewey ist nicht größer als ein Factory Outlet, das hier in den Amsterdamer Vorort Weesp auch bestens hinpassen würde.
Hinter der Glastüre, die die wirkliche Welt von dem Theaterdorf trennt, beginnt eine Fußgängerzone mit rotgeklinkerten Wegen zwischen rotgeklinkerten Flachbauten. Einen Springbrunnen gibt es hier, Skulpturen und neu gepflanzte Bäume, deren Kronen entlang der eingelassenen rechteckigen Gitter geschnitten sind. Im Schaufenster des Friseurladens hängen drei Plakate, auf denen drei junge Frauen drei Frisuren tragen.
Schwarze Klobrillen
"Wer an Alzheimer leidet, der verliert ohnehin schon den Bezug zum Leben. In einem gewöhnlichen Pflegeheim verlieren die Menschen diesen Bezug noch
mehr." Isabel van Zuthem, 40 Jahre alt, ist Sprecherin von Hogewey, zugleich aber auch ausgebildete Betreuerin. Im Restaurant, in dem sie einen Kaffee trinkt, ist wenig los, es ist ja auch noch relativ früh am morgen. Nur einer von einem guten Dutzend Tischen ist besetzt, eine Gruppe von Patienten isst. Einige von ihnen sitzen im Rollstuhl, sie sind so leise, dass man sie kaum wahrnimmt. "Es ist sehr wichtig, dass alles so normal wie möglich ist. Die Leute leben nachweislich länger, wenn die Umgebung stimulierend ist", sagt Isabel van Zuthem.
Stimulierend, das heißt in erster Linie normal und vertraut. Wie etwa die Klobrillen, die in Hogewey schwarz sind, wie es in den Niederlanden üblich ist, und nicht weiß, wie in den meisten Pflegeheimen. "Weiße Brille, weißer Fußboden - die Leute kennen das nicht und begreifen dann oft gar nicht, dass sie eine Toilette vor sich haben", sagt Isabel van Zuthem. Genauso ist es mit den Radios, in Hogewey sind das massive Geräte, die aussehen wie vor vierzig Jahren. "Demente Menschen gehen in der Zeit zurück. Wenn ich etwa sage: "Die Schlüssel liegen neben dem Radio' und damit ein modernes Radio mit Digitalanzeige meine, dann finden die Bewohner die Schlüssel nicht, weil sie das Radio nicht erkennen." Das Beiläufige ist kein Zufall in Hogewey.
Diese Welt hier ist ähnlich künstlich und durchdacht wie die des Truman Burbank aus dem Film "Die Truman Show". Im Film ist die Stadt Seahaven eine
Scheinwahrheit. Die Versicherung, die den gutgläubigen Truman angestellt hat, die Magazine, die er im Kiosk kauft, ja, sogar die Frau, die er geheiratet hat; nichts davon ist echt. Seahaven ist die komplette Illusion, nur geschaffen, um Truman Burbank in Szene zu setzen, der ohne sein Wissen der Star einer Reality-Serie ist. Die meisten Straßen in Seahaven sind übrigens rotgeklinkert.
Wer als Besucher nach Hogewey kommt, der kann in den kleinen Supermarkt gehen, sich eine Cola aus dem Kühlfach nehmen und sie bei Trudy Vernoy bezahlen. Vernoy, 51, ist die Kassiererin, jedenfalls für Gäste. Wer als Bewohner in den Supermarkt geht, muss am Ende ebenso an der Frau mit den blonden Locken und den kleinen Ringen unter den Augen vorbei, das Bezahlen kann er aber buchstäblich vergessen. Und wenn einer der Einwohner von Hogewey die Cola einfach nicht finden kann, das Shampoo oder das Gemüse, dann geht Trudy Vernoy gemeinsam mit ihm durch den Laden, solange bis der Einkaufskorb voll ist. "Ich fühle mich als Supermarktverkäuferin", sagt sie. "Aber ich arbeite hier, weil es schön ist, solche Dinge gemeinsam mit den Bewohnern zu erleben." Sämtliche Waren, die in den Regalen liegen, abzüglich des einen oder anderen Schokoriegels oder Softdrinks, die Besucher kaufen - sie decken nur den Bedarf des Wohnheims. Alles wäre ohnehin hier, nur dass es in Hogewey niemanden gibt, der einmal am Tag ins Lebensmittellager geht. Und auch kein Lebensmittellager.
"Wenn man ein Theaterstück aufführt, dann gibt es Dinge, die auf der Bühnpassieren, und solche, die Backstage ablaufen", sagt Hogewey-Sprecherin Isabel van Zuthem. "Bei uns ist das auch so. Backstage ist alles wie in einem Heim. Aber die Bewohner sehen das nicht. Für sie ist alles so normal wie möglich."
"So normal wie möglich", das bedeutet etwa, dass die Einwohner von Hogewey ihren Tag so leben sollen, wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Wer hier wohnt, muss etwa seine Wäsche waschen, trocknen und zusammenlegen. "Backstage" bedeutet, dass tatsächlich aber niemand seine Wäsche waschen muss, trocknen und zusammenlegen - wer das alles nicht mehr kann, dem helfen die Betreuer. Da diese aber auf der Bühne agieren, tragen sie keine weißen Kittel, sondern einfach Straßenkleidung.
Die Aufführung funktioniert, und zwar an vielen Stellen so gut, dass ihre Hauptdarsteller begeistert mitspielen. Für Isabel van Zuthem zeigt sich das besonders gut am Beispiel jener alten Dame, die vor Langeweile verfiel und deshalb jeden Tag Besuch von ihrer Tochter bekam - die der Mutter doch nur bei ihrem Niedergang zusehen konnte. Seit es wieder einen Haushalt zu führen gibt, hat sich das grundlegend geändert. "Jetzt beklagt sich die Tochter, dass ihre Mutter nie Zeit für sie hat. Es gibt einfach zu viel für sie zu tun", sagt van Zuthem.
Hogewey ist eine ziemlich perfekte Welt. Die Plastikstühle um den Springbrunnen herum leuchten in vier Signalfarben von Indigo bis Neongrün, auf den Beeten wächst kein Unkraut, in den Straßen liegt kein Müll. Hogewey ist akkurat - und gerade deshalb auch grotesk, denn umrahmt wird das Grundstück von zwei angrenzenden grauen Plattenbauten. Dieses kleine, niedliche Paralleluniversum wird von Achtgeschossern überragt, deren Fassaden von Satellitenschüsseln übersät sind. Die künstliche und die reale Welt stehen hier in einem seltsamen Wettstreit beieinander.
Es ist das diffuse Wissen um die Falschheit seiner Welt, das den Versicherungsangestellten Thomas A. Anderson quält. Unter dem Pseudonym "Neo" gerät die Hauptfigur des Films "Matrix" schließlich an eine Gruppe von Untergrundkämpfern, deren Anführer ihn vor die Wahl stellt, eine von zwei unterschiedlichen Pillen zu schlucken: Eine blaue Pille, die ihn alle Zweifel vergessen lässt und in sein bisheriges Leben zurückführt - oder eine rote Pille, die ihn aus der ihm bekannten Welt unwiederbringlich hinauskatapultiert. Neo wählt die rote Pille, natürlich, und lernt eine höhere Ebene der Realität kennen.
In Hogewey bekommen die Menschen die blaue Pille verabreicht und das gewissenhaft. Wer nach Hogewey geht, bezieht nicht einfach eine Wohnung, sondern er wird seinem Milieu entsprechend untergebracht. Leute, die vor der Erkrankung gerne ins Theater gingen, leben in der "kulturellen Gruppe", in der man sie erst am späten Vormittag weckt und häufig französisches und italienisches Essen serviert. Wer vom Land kommt, lebt in der "häuslichen Gruppe" mit massiven Holzmöbeln und Kartoffelbrei.
Menschen aus wohlhabenden Verhältnissen in der "Schicken Gruppe" mit klassischer Musik aus dem CD-Player und einem Rotweinsortiment in der Glasvitrine. Und da in den Niederlanden viele indonesische Migranten leben, gibt es auch in Hogewey eine entsprechende Wohngruppe; die Heizung ist hier immer ein paar Grad höher gedreht, denn die Indonesier haben es gerne warm, sagen die Betreiber. Sieben Lebensstile stehen in Hogewey zur Verfügung; der Welt, in der die Plastikstühle vier verschiedene Farben haben und die Wege rot geklinkert sind. Die Kosten für die Unterbringung, etwa 5000 Euro monatlich, zahlt die staatliche Pflegeversicherung.
Tiere stellen keine Fragen
Was vielleicht noch fehlt, ist ein kleiner Bauernhof - darauf verweist zumindest Hans-Jürgen Freter, Sprecher der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, wenn man ihn mit der Frage konfrontiert, ob es in Hogewey mit der Illusion nicht ein wenig übertrieben wird.
"Es kommt immer darauf an, eine geeignete Umgebung für den jeweiligen Menschen zu finden. Tiere sind zutraulich und stellen keine verwirrenden Fragen", sagt Freter - und spielt damit an auf das heutige Leben des Schriftstellers Walter Jens. Jens, seit 2004 an Demenz erkrankt, füttert heute Kaninchen auf einem Bauernhof, wie sein Sohn Tilman Jens vergangenes Jahr in einem Buch der Öffentlichkeit darlegte. Das ist vielleicht weniger spektakulär als die Existenz von Hogewey, beruht aber auf demselben Grundgedanken: "Demenzkranke sollten in einem Umfeld leben, das leichte Orientierung, Geborgenheit und Sicherheit gewährt", so Freter.
Und dennoch, darf man das? Was unterscheidet eigentlich die Welt Hogeweys von der des Truman Burbank? Einiges, findet Isabel van Zuthem: "Klar ist Hogewey auch Illusion. Aber nicht nur, denn alles funktioniert auch so. Demnächst ist wieder eine Aufführung im Theater und wenn Sie etwas feiern wollen, können Sie das Café mieten." Hogewey, das ist ein Supermarkt, ein Friseur, ein Beautysalon, ein Pflegeheim, Nichts von alledem und alles zugleich.
Einmal gab es einen Moment, in dem sich ein Fehler in die Aufführung schlich. Als Hogewey bezugsfertig war und die ersten Menschen aufnahm, da fehlte noch etwas, woran die Bewohner ihre Jacken hätten aufhängen können. Nicht, dass sich jemand direkt beschwert hätte. Aber jedem, der seine Wohnung verließ, fehlte etwas, das zum Hinausgehen gehört. Und jedem, der sie betrat, etwas, das zum Heimkommen gehört. "Eine Jacke gehört an den Kleiderhaken. Das muss so sein, und weil es nicht ging, wurden die Leute unruhig", sagt Isabel van Zuthem. Als hätte man rote Pillen verabreicht.