
Reportage Portrait Report Vita Impressum
Home
Reportage
Fon:
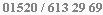
Mail:

Das Verlöschen
Edith Bussmann leidet an Alzheimer im Anfangsstadium. Ihr
Mann versucht, sich so gut es geht auf das Alltagsleben mit
dieser Krankheit vorzubereiten. Eine Ehe im Übergang
Berliner Zeitung / Frankfurter Rundschau, 18.10.2011
Edith Bussmann leidet an Alzheimer im Anfangsstadium. Ihr
Mann versucht, sich so gut es geht auf das Alltagsleben mit
dieser Krankheit vorzubereiten. Eine Ehe im Übergang
Berliner Zeitung / Frankfurter Rundschau, 18.10.2011
Drei
Bücher
hat Edith Bussmann im Laufe ihres Lebens geschrieben. Das
erste heißt „Sie hörte den Zigeuner singen“ und enthält
Erinnerungen an jene Monate ihrer Kindheit, die sie in einem
Barackenlager der Nazis verbringen musste. Das zweite, „Mondsteine“,
enthält Gedichte, es ist eine poetische Aufarbeitung dieser
Erfahrung. Und das dritte Buch ist weg. Mehrmals schon hat Edith
Bussmann ihre Wohnung danach abgesucht, erfolglos. Aber „weg“, das hat
in ihrem Leben noch eine ganz andere Bedeutung. „Ich weiß nicht
mal mehr, wie das Buch heißt. Oder worum es ging“, sagt sie.
Irgendetwas mit Gedichten muss es sein, ungefähr diese Richtung.
„Das hat dann wieder damit zu tun“, sagt sie ohne große Aufregung
in der Stimme. Inzwischen hat so einiges „damit“ zu tun.
Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass Edith Bussmann ihre Hausärztin aufsuchte. Etwas stimmte nicht. Sie hatte beim Aufräumen Notizen weggeworfen, die ihr eigentlich sehr wichtig waren – und das nicht nur einmal, wie es jedem passieren kann, sondern wieder und wieder. Die Ärztin schaute ihr nicht ins Gesicht und tippte die ganze Zeit in ihren Computer. Am Ende wurde Edith Bussmann Blut abgenommen, dann bekam sie eine Überweisung zu einem Spezialisten. Als sie auf den Zettel schaute, las sie das Wort „Demenz“. Es war der Anfang eines neuen Lebens.
Langsames, aber stetiges Verlieren
Edith Bussmann ist 82 Jahre alt, sie hat schlohweißes Haar und trägt eine Brille. Gemeinsam mit ihrem Mann Christoph, 84, lebt sie in einer ruhigen Gegend am Rande von Stuttgart. An den Wänden ihrer kleinen Wohnung hängen Porträts und abstrakte Bilder, die die beiden selbst gemalt haben. Zweimal in der Woche kommt jemand, der sich um den Garten kümmert, ansonsten erledigt Edith Bussmann im Haushalt alles selbst. Auch das Kochen: Sie hat darauf bestanden, Frikadellen zu servieren, mit Kartoffelsalat und Rosenkohl. Der Rosenkohl ist angebrannt, das sieht man schon von weitem. „Für mich bitte nicht. Du weißt ja, dass ich es mit Gemüse nicht so habe“, sagt Christoph Bussmann zu seiner Frau.
Ein fremder Name
Kämpfen lernen musste Edith Bussmann schon früh in ihrem Leben. Ihr Vater war SPD-Mitglied, 1935 nahmen ihn die Nazis fest. Die Familie durfte nicht in ihrer Wohnung bleiben, Edith Bussmann, ihre Mutter und ihre zwei Geschwister kamen ins Barackenlager: zwei winzige Räume für die ganze Familie, eine Latrine für den ganzen Block und viel zu viele Menschen. Ein Ort, noch um einiges entfernt von den nationalsozialistischen Mordfabriken, aber für manche Nachbarn wurde er zur Zwischenstation dorthin. Für Edith Bussmanns Familie nicht. Sie wurde nicht noch tiefer hineingerissen in den Abgrund der Gewalt. Der Vater überlebte die Tortur im KZ – 1944 ließ man ihn wegen eines Herzleidens frei.
„Wichtgen, jetzt brauchst nicht mehr zu weinen!“, ruft Edith Bussmann und muss nun gerade weinen. Niemand hatte ihnen gesagt, dass der Vater freikommt, die Mutter war arbeiten und die Tochter in der Schule. Als sie nach Hause kam, stand er einfach da. Sie heulte los, weinte und weinte. Der Vater nahm sie in den Arm, strich ihr über das Haar. „Wichtgen, jetzt brauchst nicht mehr zu weinen!“, sagte er. Wichtgen war sein Kosename für sie. „Meine Mutter ist dann später auch in die Partei eingetreten“, sagt Edith Bussmann plötzlich. In die Partei? „Ja, nach dem Krieg.“ Sie sucht nach Worten. „Sozialdemokraten!“, ruft sie und atmet tief.
Später stößt Edith Bussmann noch einmal einen ähnlichen Triumphschrei aus: „Taube und Dornenzweig!“ Das ist es, das dritte Buch. Sie hält ein grünes Bändchen in der Hand. Auf dem Umschlag steht ein fremder Autorenname. Es ist eine Anthologie, aber: Sie enthält auch eines ihrer Gedichte.
Dann gibt es Kuchen. Edith Bussmann hat ihn selbst gebacken. Es ist ein sehr süßer Kuchen, luftig und saftig, mit vielen Schokostreuseln. Er schmeckt toll. „Ein einfacher Rührkuchen“, sagt Christoph Bussmann. Es ist höflich gemeint.
Unter welcher Form der Demenz Edith Bussmann leidet, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es Alzheimer, aber besser kann man das erst nach einigen Tests sagen, die sie noch absolvieren muss. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Es liegt im Wesen dementieller Erkrankungen, dass eine exakte Diagnose schwierig ist und ihre Abgrenzung nicht immer möglich.
Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass Edith Bussmann ihre Hausärztin aufsuchte. Etwas stimmte nicht. Sie hatte beim Aufräumen Notizen weggeworfen, die ihr eigentlich sehr wichtig waren – und das nicht nur einmal, wie es jedem passieren kann, sondern wieder und wieder. Die Ärztin schaute ihr nicht ins Gesicht und tippte die ganze Zeit in ihren Computer. Am Ende wurde Edith Bussmann Blut abgenommen, dann bekam sie eine Überweisung zu einem Spezialisten. Als sie auf den Zettel schaute, las sie das Wort „Demenz“. Es war der Anfang eines neuen Lebens.
Langsames, aber stetiges Verlieren
Edith Bussmann ist 82 Jahre alt, sie hat schlohweißes Haar und trägt eine Brille. Gemeinsam mit ihrem Mann Christoph, 84, lebt sie in einer ruhigen Gegend am Rande von Stuttgart. An den Wänden ihrer kleinen Wohnung hängen Porträts und abstrakte Bilder, die die beiden selbst gemalt haben. Zweimal in der Woche kommt jemand, der sich um den Garten kümmert, ansonsten erledigt Edith Bussmann im Haushalt alles selbst. Auch das Kochen: Sie hat darauf bestanden, Frikadellen zu servieren, mit Kartoffelsalat und Rosenkohl. Der Rosenkohl ist angebrannt, das sieht man schon von weitem. „Für mich bitte nicht. Du weißt ja, dass ich es mit Gemüse nicht so habe“, sagt Christoph Bussmann zu seiner Frau.
Edith
Bussmann
verliert sich, langsam, aber stetig – das ist ihr völlig
klar und das war auch der Grund, für diese Einladung. „Ich muss
mein Leben bestehen“, sagt sie. Sie führt einen Kampf, den sie
verlieren wird. Aber sie möchte dabei wahrgenommen werden. Ihr
Mann hilft ihr dabei, so gut er eben kann.
Sie
hat
einen fremden Menschen gebeten, zu ihr zu kommen, sie hat ihm
angebrannten Rosenkohl serviert und auch den Namen ihres eigenen Buches
nicht nennen können. Sie hat das nicht vorhergesehen und manches
vermutlich gar nicht mitbekommen – dass sie einem Journalisten
Unzulänglichkeiten vorleben würde, war ihr bewusst. All das
unter ihrem echten Namen. „Wenn ein junger Mensch krank ist, wird er
bemitleidet“, sagt sie. „Bei einer alten Frau heißt es immer nur:
Die spinnt!“
Manchmal, wenn sie erschöpft ist, kann sie den Feind, der allmählich von ihrem Leben Besitz ergreift, nicht mehr erkennen. Dann kommt es vor, dass sich die Bedrohung, der sie sich heute ausgesetzt sieht, und die Bedrohung, die sie in ihren jungen Jahren erfuhr, auf seltsame Weise überblenden. Dann sagt sie Sätze wie „Demenz ist ein Tabuthema, obwohl dieser Adolf Hitler so viel Unheil angerichtet hat“. Je weiter sich Edith Bussmann in ihre eigene Welt zurückzieht, desto näher kommt sie auch wieder ihrer Kindheit, einer Zeit, die vom Nationalsozialismus geprägt war.
Manchmal, wenn sie erschöpft ist, kann sie den Feind, der allmählich von ihrem Leben Besitz ergreift, nicht mehr erkennen. Dann kommt es vor, dass sich die Bedrohung, der sie sich heute ausgesetzt sieht, und die Bedrohung, die sie in ihren jungen Jahren erfuhr, auf seltsame Weise überblenden. Dann sagt sie Sätze wie „Demenz ist ein Tabuthema, obwohl dieser Adolf Hitler so viel Unheil angerichtet hat“. Je weiter sich Edith Bussmann in ihre eigene Welt zurückzieht, desto näher kommt sie auch wieder ihrer Kindheit, einer Zeit, die vom Nationalsozialismus geprägt war.
Ein fremder Name
Kämpfen lernen musste Edith Bussmann schon früh in ihrem Leben. Ihr Vater war SPD-Mitglied, 1935 nahmen ihn die Nazis fest. Die Familie durfte nicht in ihrer Wohnung bleiben, Edith Bussmann, ihre Mutter und ihre zwei Geschwister kamen ins Barackenlager: zwei winzige Räume für die ganze Familie, eine Latrine für den ganzen Block und viel zu viele Menschen. Ein Ort, noch um einiges entfernt von den nationalsozialistischen Mordfabriken, aber für manche Nachbarn wurde er zur Zwischenstation dorthin. Für Edith Bussmanns Familie nicht. Sie wurde nicht noch tiefer hineingerissen in den Abgrund der Gewalt. Der Vater überlebte die Tortur im KZ – 1944 ließ man ihn wegen eines Herzleidens frei.
„Wichtgen, jetzt brauchst nicht mehr zu weinen!“, ruft Edith Bussmann und muss nun gerade weinen. Niemand hatte ihnen gesagt, dass der Vater freikommt, die Mutter war arbeiten und die Tochter in der Schule. Als sie nach Hause kam, stand er einfach da. Sie heulte los, weinte und weinte. Der Vater nahm sie in den Arm, strich ihr über das Haar. „Wichtgen, jetzt brauchst nicht mehr zu weinen!“, sagte er. Wichtgen war sein Kosename für sie. „Meine Mutter ist dann später auch in die Partei eingetreten“, sagt Edith Bussmann plötzlich. In die Partei? „Ja, nach dem Krieg.“ Sie sucht nach Worten. „Sozialdemokraten!“, ruft sie und atmet tief.
Später stößt Edith Bussmann noch einmal einen ähnlichen Triumphschrei aus: „Taube und Dornenzweig!“ Das ist es, das dritte Buch. Sie hält ein grünes Bändchen in der Hand. Auf dem Umschlag steht ein fremder Autorenname. Es ist eine Anthologie, aber: Sie enthält auch eines ihrer Gedichte.
Dann gibt es Kuchen. Edith Bussmann hat ihn selbst gebacken. Es ist ein sehr süßer Kuchen, luftig und saftig, mit vielen Schokostreuseln. Er schmeckt toll. „Ein einfacher Rührkuchen“, sagt Christoph Bussmann. Es ist höflich gemeint.
Unter welcher Form der Demenz Edith Bussmann leidet, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es Alzheimer, aber besser kann man das erst nach einigen Tests sagen, die sie noch absolvieren muss. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Es liegt im Wesen dementieller Erkrankungen, dass eine exakte Diagnose schwierig ist und ihre Abgrenzung nicht immer möglich.
Vielleicht
auch
nicht immer nötig, findet Peter Wißmann: „Eine Diagnose
,Alzheimerdemenz' suggeriert zwar Klarheit, verschleiert aber, dass
sich hinter dem, was man gewöhnlich so bezeichnet, tausende sehr
individuelle und kaum vergleichbare Schicksale verbergen“, sagt der
Wissenschaftliche Leiter von „Demenz Support Stuttgart“, einer
gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt,
dementen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen und Vorurteilen entgegenzuwirken. „Im Grunde wissen
die meisten Menschen gar nichts über Demenz“, sagt Wißmann.
Bei
Edith
Bussmann äußert sich die Demenz zum Beispiel auch
darin, dass sie davon überzeugt ist, infolge der Krankheit
würden ihre Haare ausbleichen. Schwarz seien sie gewesen, noch vor
kurzer Zeit – und eines Morgens schlohweiß. „Damals wusste ich
noch nicht, dass das an der Demenz liegt“, sagt sie. „Schatz, meine
Haare sind auch grau und ich habe keine Demenz“, entgegnet Christoph
Bussmann.
Es
ist
nicht der einzige Punkt, an dem er ihr widerspricht. In Edith
Bussmanns jüngerer Vergangenheit gibt es eine Episode, an die sie
sich nur schemenhaft erinnert. Kurz nach der ersten, vorläufigen
Diagnose muss das gewesen sein, sie lag die ganze Zeit auf dem Sofa und
hatte keine Lust. Jede Bewegung fiel ihr schwer und jeder Gedanke auch.
„Ich bin heute überzeugt, dass ich einen Schlaganfall hatte. Aber
keiner sagt mir was.“ Christoph Bussmann schaut in diesem Moment auf
die Tischplatte. „Wir liegen doch alle mal auf dem Sofa“, sagt er leise.
Die Edith Bussmann, die sich über ihre Haarfarbe wundert und die glaubt, einen Schlaganfall erlitten zu haben, ist eine Person, die sich nur kurzen Momenten zeigt. Es gibt auch eine Edith Bussmann, die ihrem Mann die Frage beantwortet, wie alt ihre gemeinsame Tochter jetzt sei, und die ihn sanft dafür tadelt, als er einmal ein volles Wasserglas umkippt. Es sind erprobte Rollen, in denen sie leben, und meistens funktioniert das Zusammenspiel: „Ist der Tisch noch nass?“, ruft sie später aus dem Nebenraum. „Nein, nein“, antwortet er und wischt unauffällig ein paar Tropfen beiseite.
Vor einiger Zeit hat Edith Bussmann ein Bild gemalt. Es erinnert in seiner ausladenden, weitläufigen Stilistik ein wenig an den Impressionismus. Vor einem blauen Hintergrund ist schemenhaft in hellen Tönen eine Figur zu erahnen, die von wilden grünen Strichen umrandet wird. Über die ganze Komposition hat Edith Bussmann ein Muster aus schwarzen Linien gelegt. Nichts an diesem Bild ist zufällig. „Das Himmelszelt lacht, aber der Wirrwarr bleibt“, interpretiert sie ihr Werk. „Aber die schwarzen Linien regeln das wieder.“
Diese „Wer sind denn Sie?“-Situation
Die Edith Bussmann, die sich über ihre Haarfarbe wundert und die glaubt, einen Schlaganfall erlitten zu haben, ist eine Person, die sich nur kurzen Momenten zeigt. Es gibt auch eine Edith Bussmann, die ihrem Mann die Frage beantwortet, wie alt ihre gemeinsame Tochter jetzt sei, und die ihn sanft dafür tadelt, als er einmal ein volles Wasserglas umkippt. Es sind erprobte Rollen, in denen sie leben, und meistens funktioniert das Zusammenspiel: „Ist der Tisch noch nass?“, ruft sie später aus dem Nebenraum. „Nein, nein“, antwortet er und wischt unauffällig ein paar Tropfen beiseite.
Vor einiger Zeit hat Edith Bussmann ein Bild gemalt. Es erinnert in seiner ausladenden, weitläufigen Stilistik ein wenig an den Impressionismus. Vor einem blauen Hintergrund ist schemenhaft in hellen Tönen eine Figur zu erahnen, die von wilden grünen Strichen umrandet wird. Über die ganze Komposition hat Edith Bussmann ein Muster aus schwarzen Linien gelegt. Nichts an diesem Bild ist zufällig. „Das Himmelszelt lacht, aber der Wirrwarr bleibt“, interpretiert sie ihr Werk. „Aber die schwarzen Linien regeln das wieder.“
Diese „Wer sind denn Sie?“-Situation
Das
Malen
ist nicht ihr einziges Mittel, mit der Krankheit umzugehen. „Wenn
mich etwas belastet, muss ich schreiben. Das hat mir in meinem Leben
immer geholfen“, sagt sie. Frau Bussmann, worüber haben Sie denn
als letztes geschrieben? „Ich weiß es nicht.“ Eine Frage, wie sie
harmloser kaum sein könnte und man fühlt sie auf einmal wie
mitten in einem Verhör. „Schatz, Du hast in letzter Zeit
öfter mal etwas angefangen“, sagt Christoph Bussmann.
Ursprünglich
kommen
die Bussmanns aus dem westfälischen Münster, aber
bevor sie vor ungefähr zehn Jahren in die Nähe ihrer
erwachsenen Tochter nach Stuttgart zogen, lebten sie lange Zeit im
bayerischen Ingolstadt. Edith Bussmann gab dort Volkshochschulkurse,
sie war eine angesehene Lehrerin. Ein Manuskript, das sie dort vielen
Freunden zu lesen gab, hat siebzig Seiten. „philosophische
Betrachtungen“, säuberlich mit der Schreibmaschine getippt. Eine
durchdachte Sache, etwas mit Anfang und Ende. Heute produziert sie nur
noch Anfänge. „Eine Weile wollte ich zurück nach Ingolstadt“,
sagt sie. Aber das sei jetzt vorbei: „Eine Demenz muss man annehmen.“
Sie schreitet ja voran. Die Eheleute haben sich geeinigt, dass Christoph Bussmann einen Blick auf den Müll wirft, bevor sie ihn herausbringen. „Mit Mülltrennung hat meine Frau inzwischen Probleme“, sagt er. Es wird nicht dabei bleiben. Irgendwann wird es Edith Bussmann sein, die das Alter ihrer Tochter vergisst und die Wassergläser umwirft. Und ihr Ehemann wird es sein, der ihren Teil der Verantwortung für ihr gemeinsamen Leben mitübernehmen muss. Darauf angesprochen zuckt Christoph Bussmann mit den Schultern. „So weit denke ich noch gar nicht, weil wir heute noch so klarkommen.“ Viele Kreuzworträtsel würden sie gemeinsam lösen, das halte den Geist wach. Was soll man auch antworten auf eine Frage, wie man in einer Welt lebt, in der es kein Öl mehr gibt?
Ein intaktes Gedächtnis kann ein Fluch sein – dann nämlich, wenn man vor der Entscheidung steht, eine schmeichelhafte Lüge zu erzählen oder eine brutale Wahrheit. Christoph Bussmann entscheidet sich für letzteres. „Doch Schatz, das hatten wir schon“, sagt er auf die Frage, ob es schon einmal vorgekommen sei, dass ihn seine Frau nicht mehr erkannt hat, als er nach dem Gang zum Bäcker an der Wohnungstür stand. Diese „Wer sind denn Sie?“-Situation ist ein klassisches Symptom im Verlauf einer Demenzerkrankung. Aber seine Ehrlichkeit im Umgang mit diesem wohl schmerzhaftesten Gedächtnisverlust, der sich für eine Beziehung vorstellen lässt, ist für sie nicht kränkend, sondern befreiend. Denn seine Frau kennt die Wahrheit, jedenfalls im Augenblick. „Das hatten wir aber noch nicht oft“, entgegnet Edith Bussmann.
Sie schreitet ja voran. Die Eheleute haben sich geeinigt, dass Christoph Bussmann einen Blick auf den Müll wirft, bevor sie ihn herausbringen. „Mit Mülltrennung hat meine Frau inzwischen Probleme“, sagt er. Es wird nicht dabei bleiben. Irgendwann wird es Edith Bussmann sein, die das Alter ihrer Tochter vergisst und die Wassergläser umwirft. Und ihr Ehemann wird es sein, der ihren Teil der Verantwortung für ihr gemeinsamen Leben mitübernehmen muss. Darauf angesprochen zuckt Christoph Bussmann mit den Schultern. „So weit denke ich noch gar nicht, weil wir heute noch so klarkommen.“ Viele Kreuzworträtsel würden sie gemeinsam lösen, das halte den Geist wach. Was soll man auch antworten auf eine Frage, wie man in einer Welt lebt, in der es kein Öl mehr gibt?
Ein intaktes Gedächtnis kann ein Fluch sein – dann nämlich, wenn man vor der Entscheidung steht, eine schmeichelhafte Lüge zu erzählen oder eine brutale Wahrheit. Christoph Bussmann entscheidet sich für letzteres. „Doch Schatz, das hatten wir schon“, sagt er auf die Frage, ob es schon einmal vorgekommen sei, dass ihn seine Frau nicht mehr erkannt hat, als er nach dem Gang zum Bäcker an der Wohnungstür stand. Diese „Wer sind denn Sie?“-Situation ist ein klassisches Symptom im Verlauf einer Demenzerkrankung. Aber seine Ehrlichkeit im Umgang mit diesem wohl schmerzhaftesten Gedächtnisverlust, der sich für eine Beziehung vorstellen lässt, ist für sie nicht kränkend, sondern befreiend. Denn seine Frau kennt die Wahrheit, jedenfalls im Augenblick. „Das hatten wir aber noch nicht oft“, entgegnet Edith Bussmann.